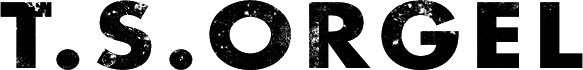Gestern den Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ gesehen.
Eigentlich ein richtig unterhaltsamer Film mit einer Menge schwarzem Humor und herrlich schrägen Charakteren, super gespielt von einer Riege hochkarätiger Schauspieler. Der Film hat schon eine Menge Preise abgesahnt und wird höchstwahrscheinlich auch von den Oscars nicht verschont bleiben. Schließlich ist eines der Themen der Rassismus und die alltägliche Gewalt gegen Schwarze. Also eigentlich eine klare und unterstützenswerte Sache. Noch dazu, wenn sie so toll umgesetzt wurde. Und trotzdem bin ich rausgegangen und dachte mir: Hm. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass dieser Film rassistisch ist.
Hä? Ein Film der sich gegen Rassismus ausspricht aber rassistisch ist?
Ich versuche das mal zu erklären: Jeder dieser Charaktere hat irgendeine Macke: ist rassistisch, sexistisch, gewalttätig, bescheuert oder einfach nur komplett irre. Jeder dieser Charaktere ist ein echtes Unikum. Mildred (grandios: Frances McDormand) ist gewalttätig, frustriert und voller Trauer. Sheriff Willoughby (Woody Harrelson als Woody Harrelson) ist handfest, pragmatisch und zutiefst verzweifelt. Officer Dixon (spielt sich die Seele aus dem Leib: Sam Rockwell) ist ein rassistisches, gewalttätiges Muttersöhnchen, und Midget James (ein wie immer gut aufgelegter Peter Dinklage) hat auch mächtig einen an der Klatsche.
Allesamt sind sie so schön schräg, dass man sie einfach mögen muss. Jeden Einzelnen auf seine Art, egal ob er eine ‚cunt‘ ist (häufig verwendetes Wort im Film) oder einfach nur ein armes Würstchen.
Was gemerkt? Kein Einziger ist schwarz.
Ist der Film also rassistisch, weil darin keine Schwarzen auftauchen?
Nee, keine Sorge, die gibt es natürlich auch. Sogar gleich drei davon. Da wäre zum Beispiel Mildreds hübschnette Freundin mit der sie den Laden führt und die von der Polizei ungerechtfertigterweise verhaftet wird. Oder der schwarze Typ von Nebenan, der die Plakate aufhängt und ihr am Ende hilft. Oder der neue Polizeichef, der sich direkt mal die rassistischen Kollegen vorknöpft. Alle drei zusammengenommen sind so interessant wie ein ein nasser Waschlappen im Altenheim. So interessant, dass ich mir noch nicht einmal ihre Namen gemerkt habe. Keiner hat eine Macke, keiner ist irre – nicht einmal gewalttätig oder witzig oder auf irgendeine erkennbare Art lebendig.
Dieser Film ist meiner Meinung nach rassistisch, weil er die Schwarzen nicht gleichwertig behandelt. Weil er meint, sie mit Samthandschuhen anfassen zu müssen. Um Gottes Willen nur ja keine schwarzen Flecken (haha) auf ihrer weißen Weste hinterlassen und so. Könnte sich ja jemand getroffen fühlen. In einem Film in dem sich jeder Weiße die Seele aus dem Leib spielen darf, sind die Schwarzen nur Staffage, political correctness sei Dank.
Dabei geht es doch auch anders. Wer schon damals, immerhin 1987, „Lethal Weapon“ gesehen hat, der weiß, wie die Rolle eines schwarzen Polizisten mit Ecken und Kanten tatsächlich aussehen kann. Ich sag nur: Danny Glover! Und Mildreds Freundin hätte dringend eine Prise Jackie Brown nötig, also einfach ein bisschen Ambivalenz. Statt dessen: nichts. Null, nada, niente. Schauspielerisches Potential verschenkt.
Und die Moral von der Geschicht?
Da ich mich inzwischen ja doch schon als so eine Art Schriftsteller bezeichnen kann, frage ich mich: muss das sein? Tue ich den Menschen wirklich einen Gefallen, wenn ich sie als gesichtslose Heilige darstelle?
Wenn ich mir irgendeine x-beliebige Geschichte anschaue, dann sind doch die interessantesten Leute gerade die mit ordentlich Ecken und Kanten. Selbst in unseren eigenen Büchern mögen die Leser diejenigen Charaktere am meisten, die ordentlich Dreck am Stecken haben – nicht die strahlenden, unfehlbaren, moralisch überlegenen Helden. Wir mögen doch alle lieber einen Menschen, der menschlich ist. Mit all seinen Selbstzweifeln, Fehlern und dunklen Seiten.
Ein rassistischer Held also? Warum eigentlich nicht? Wenn ich das schlüssig erklären kann, sehe ich da kaum ein Problem (wie man im obigen Film ja bei den meisten Charakteren prima sehen kann). Klar, man fühlt als Autor immer auch das Bedürfnis, erzieherisch tätig zu sein. Der moralische Zeigefinger ist beim Schreiben schon halb erhoben, und manchmal kann man sich beim besten Willen nicht verkneifen ihn auszustrecken. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Zeigefinger und Holzhammer.
Was wirkt denn realistischer und regt vielleicht ein bisschen zum Nachdenken an? Der von Grund auf böse, standesgemäß irre lachende Nazigeneral, oder ein Skinhead der sich liebevoll um seine an Alzheimer erkrankte Mutter kümmert? Schon wieder eine hoch gebildete, intelligente aber zu Unrecht unterdrückte Minderheit, oder nicht vielleicht zur Abwechslung mal ein schwarzer Polizist, der Witze über Schlitzaugen macht, und illegale mexikanische Einwanderer schikaniert, weil die immer nur Ärger verursachen?
Eine Geschichte braucht nicht immer eine Moral, um gut zu sein. Und schon gleich gar keine plakativen, gesichtslosen Pappaufsteller die eher nur das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich sollen: nämlich irgendwann im Laufe des Film das unstillbare Bedürfnis zu erzeugen, ihnen in die Fresse hauen zu wollen. Nur damit sie einfach mal irgend ein echtes Gefühl zeigen. Oder wenigsten ein kleines bisschen fluchen. So wie Menschen halt.